
www.peterliechti.ch
Peter Liechti
Existenzielle Einsamkeit
Interview: Peter Liechti: Tabu Selbstmord
erschienen am 5. 05. 2010

Film Kino Text
Das Summen der Insekten
Ricore: Das Summen der Insekten ist ein fesselnder Film. Was genau hat sie an der Thematik so fasziniert?
Peter Liechti: Im ersten Moment war mir das selbst nicht klar. Zum ersten Mal hab ich es als CD, als eine Art Hörspiel gehört. Es wurde von japanischen Musikern aufgeführt und von einem österreichischen Radio gesendet. Das hat mich vollkommen reingezogen, ich fand es bis zum letzten Moment spannend. Erklären konnte ich mir das nicht, weil mich die Geschichte objektiv im ersten Moment eigentlich nicht interessierte.
Ricore: Meinen sie nicht, dass die öffentliche Bearbeitung des Themas Suizid in der Schweiz für das Interesse mitverantwortlich war, zumindest unterbewusst?
Liechti: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Anfangs empfand ich die Geschichte als sehr panisch. Dann aber als etwas sehr Universelles. Was mich so gepackt hat, ist, dass es im Grunde eine sehr radikale Form der Herausforderung des Lebens ist. Im Grunde geht es ja nicht um den Tod, sondern um das Leben. Die Herausforderung des Lebens bis zum Letzten, bis zur letzten Konsequenz. Die ist dann eben der Tod.
Ricore: Sie sagen also, dass der wirkliche Protagonist, der Selbstmörder in Japan, aufgrund seiner Lebensfrustration keinen anderen Ausweg mehr wusste, als sich zu töten?
Liechti: Es geht mehr um den Lebenshunger. Ich glaube, dass er erst mal daran verhungert ist, an seinem früheren Leben. Dass ihm das ursprüngliche soziale Leben in der Großstadt nicht genügt hat, dass er sich dort nicht genügend einbringen konnte. Und dann hat er, fast aus einem persönlichen Heroismus heraus, sein Leben soweit herausgefordert, bis er zu diesem Experiment gelangt ist. Ich denke, dass diese letzten zwei Monate in seinem Leben vielleicht die intensivsten waren, wenn auch die fürchterlichsten. Aber er konnte sich zuvor nie selbst so stark erfahren, als Mensch, als Individuum.
Ricore: Inwieweit konnten sie sich als Filmemacher in den Standpunkt des Protagonisten hineinversetzen, sein Tun nachvollziehen?
Liechti: Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto besser hat es funktioniert. Vor allem als ich dann im Schnittraum versucht habe, das ganze Material in Bezug auf seine Befindlichkeiten wiederherzustellen. Da konnte ich mich sehr gut mit ihm identifizieren. Im Wald war dies weniger der Fall. Da war ich zu sehr der Filmemacher. Aber genau das ist auch das Interessante an dem Stoff. Der Zuschauer findet eine Ebene, auf der er sich mit dem Sterbenden identifiziert. Alle wollen, dass er nicht gefunden wird, dass ihm sein Vorhaben gelingt. Und das ist ja eigentlich sehr merkwürdig.
Peter Liechti: Im ersten Moment war mir das selbst nicht klar. Zum ersten Mal hab ich es als CD, als eine Art Hörspiel gehört. Es wurde von japanischen Musikern aufgeführt und von einem österreichischen Radio gesendet. Das hat mich vollkommen reingezogen, ich fand es bis zum letzten Moment spannend. Erklären konnte ich mir das nicht, weil mich die Geschichte objektiv im ersten Moment eigentlich nicht interessierte.
Ricore: Meinen sie nicht, dass die öffentliche Bearbeitung des Themas Suizid in der Schweiz für das Interesse mitverantwortlich war, zumindest unterbewusst?
Liechti: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Anfangs empfand ich die Geschichte als sehr panisch. Dann aber als etwas sehr Universelles. Was mich so gepackt hat, ist, dass es im Grunde eine sehr radikale Form der Herausforderung des Lebens ist. Im Grunde geht es ja nicht um den Tod, sondern um das Leben. Die Herausforderung des Lebens bis zum Letzten, bis zur letzten Konsequenz. Die ist dann eben der Tod.
Ricore: Sie sagen also, dass der wirkliche Protagonist, der Selbstmörder in Japan, aufgrund seiner Lebensfrustration keinen anderen Ausweg mehr wusste, als sich zu töten?
Liechti: Es geht mehr um den Lebenshunger. Ich glaube, dass er erst mal daran verhungert ist, an seinem früheren Leben. Dass ihm das ursprüngliche soziale Leben in der Großstadt nicht genügt hat, dass er sich dort nicht genügend einbringen konnte. Und dann hat er, fast aus einem persönlichen Heroismus heraus, sein Leben soweit herausgefordert, bis er zu diesem Experiment gelangt ist. Ich denke, dass diese letzten zwei Monate in seinem Leben vielleicht die intensivsten waren, wenn auch die fürchterlichsten. Aber er konnte sich zuvor nie selbst so stark erfahren, als Mensch, als Individuum.
Ricore: Inwieweit konnten sie sich als Filmemacher in den Standpunkt des Protagonisten hineinversetzen, sein Tun nachvollziehen?
Liechti: Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto besser hat es funktioniert. Vor allem als ich dann im Schnittraum versucht habe, das ganze Material in Bezug auf seine Befindlichkeiten wiederherzustellen. Da konnte ich mich sehr gut mit ihm identifizieren. Im Wald war dies weniger der Fall. Da war ich zu sehr der Filmemacher. Aber genau das ist auch das Interessante an dem Stoff. Der Zuschauer findet eine Ebene, auf der er sich mit dem Sterbenden identifiziert. Alle wollen, dass er nicht gefunden wird, dass ihm sein Vorhaben gelingt. Und das ist ja eigentlich sehr merkwürdig.

www.peterliechti.ch
Peter Liechti
Ricore: Wie ist es mit einem versteckten Überlebenswunsch des Sterbenden?
Liechti: Natürlich hat er diese Gedanken. Er ist sehr menschlich, keineswegs souverän. Er zweifelt ja auch an seinem Vorhaben und stellt in einem Moment fest, es wäre der letzte, in dem er es noch zurück ins Leben schaffen könnte. Dann entscheidet er sich doch dafür, die ganze Sache durchzuziehen. Das ist dramaturgisch auch sehr wichtig, schon im Text. Die Tatsache, dass er seinen Entschluss noch einmal so betont. Ich glaube zwar nicht, dass er den Entschluss bereut, er merkt aber sehr wohl, was für eine Kraft, eine Energie das Leben von ihm fordert. Schließlich hat er sich alles viel einfacher vorgestellt, dass alles viel schneller gehen würde.
Ricore: Welche Rolle spielt hierbei der ständige Regen?
Liechti: Hätte es nicht die ganze Zeit geregnet, wäre er sicher früher gestorben, er wäre verdurstet.
Ricore: War das in der wahren Geschichte auch der Fall?
Liechti: Die Fundstelle war in Hokaido, im Norden Japans. Dort regnet es sehr viel.
Ricore: Hat er sich den Ort also aufgrund des Regens ausgesucht, vielleicht um doch gefunden zu werden?
Liechti: So habe ich das nie betrachtet. Ich glaube, er ist einfach losgezogen, ziemlich naiv. Zentral ist seine Vorstellung, dass alles viel schneller ablaufen sollte. Absurderweise hat er sich ja Wasser mitgenommen, obwohl es dort so viel regnet.
Ricore: Nach welchen Kriterien haben sie den Drehort ausgewählt?
Liechti: Es sollte auf keinen Fall ein extremer Ort sein, kein bestimmtes Land. Es hätte Kanada, Europa, Japan sein können, da wollte ich mich nicht festlegen. Es ging um den Wald, den es nun mal überall gibt. Und da ist auch wieder die Universalität.
Liechti: Natürlich hat er diese Gedanken. Er ist sehr menschlich, keineswegs souverän. Er zweifelt ja auch an seinem Vorhaben und stellt in einem Moment fest, es wäre der letzte, in dem er es noch zurück ins Leben schaffen könnte. Dann entscheidet er sich doch dafür, die ganze Sache durchzuziehen. Das ist dramaturgisch auch sehr wichtig, schon im Text. Die Tatsache, dass er seinen Entschluss noch einmal so betont. Ich glaube zwar nicht, dass er den Entschluss bereut, er merkt aber sehr wohl, was für eine Kraft, eine Energie das Leben von ihm fordert. Schließlich hat er sich alles viel einfacher vorgestellt, dass alles viel schneller gehen würde.
Ricore: Welche Rolle spielt hierbei der ständige Regen?
Liechti: Hätte es nicht die ganze Zeit geregnet, wäre er sicher früher gestorben, er wäre verdurstet.
Ricore: War das in der wahren Geschichte auch der Fall?
Liechti: Die Fundstelle war in Hokaido, im Norden Japans. Dort regnet es sehr viel.
Ricore: Hat er sich den Ort also aufgrund des Regens ausgesucht, vielleicht um doch gefunden zu werden?
Liechti: So habe ich das nie betrachtet. Ich glaube, er ist einfach losgezogen, ziemlich naiv. Zentral ist seine Vorstellung, dass alles viel schneller ablaufen sollte. Absurderweise hat er sich ja Wasser mitgenommen, obwohl es dort so viel regnet.
Ricore: Nach welchen Kriterien haben sie den Drehort ausgewählt?
Liechti: Es sollte auf keinen Fall ein extremer Ort sein, kein bestimmtes Land. Es hätte Kanada, Europa, Japan sein können, da wollte ich mich nicht festlegen. Es ging um den Wald, den es nun mal überall gibt. Und da ist auch wieder die Universalität.

www.peterliechti.ch
Peter Liechti hantiert mit seiner Kamera
Ricore: Wo wurde denn gedreht?
Liechti: In der Schweiz. Allerdings an verschiedenen Orten. Auch die Großstädte sind nicht immer die Gleichen.
Ricore: Welche Botschaft haben Sie für Ihre Zuschauer?
Liechti: Es ist eine Art von Gesellschaftskritik, die ich in dem Film formuliere. Was ausgedrückt wird, ist die radikale Verweigerung, das mitzumachen, was einem angeboten wird, den Konsum also. Die radikalste Verweigerung ist eben der totale Verzicht auf Essen.
Ricore: Es soll also die Askese ins Unendliche gesteigert werden?
Liechti: Naja, also Askese hat dann wieder diesen religiösen Aspekt. Zwar kommt der auch hinein, was wohl letztlich immer der Fall ist, wenn man stirbt. Da kommen immer religiöse Reflexionen, ob man will oder nicht, bei ihm ja auch. Ausschlaggebend war aber, dass ihm das Angebot in der Gesellschaft nicht gereicht hat. Er hat keine Befriedigung gefunden und konnte auch selbst nichts aus seinem Leben machen. Daraus entstand dann der Wunsch nach kompletter Verweigerung. Auf der anderen Seite ist der Film ein Plädoyer für das Leben. Indem man es hergibt zeigt sich erst seine Kostbarkeit.
Ricore: Geht es um eine Aufforderung an die Zuschauer zu kämpfen und niemals aufzugeben?
Liechti: Absolut. Viele Zuschauer erzählten mir, sie hätten den Film als eine Art Reinigung empfunden, nahezu eine katharsische Wirkung verspürt. Während es Films hätten sie gelitten, am Ende dann ein riesige Erleichterung erlebt.
Ricore: Woher kommt die Erleichterung?
Liechti: Der Wert des eigenen Lebens wird mal wieder hinterfragt, man wird sich bewusst, wie wertvoll es ist. Ebenso ist man erleichtert, dass man nicht ein solches Leid erfahren muss, wie der Protagonist.
Ricore: Inwiefern ist ein Selbstmord egoistisch?
Liechti: Mit Egoismus hat das meiner Ansicht nach nichts zu tun, mehr mit Egozentrik. Jeder der Selbstmordgedanken hegt, ist extrem selbstbezogen, bezieht die Tat auf seine Person. Diese ethnografischen Überlegungen spielten allerdings keine wichtige Rolle in Bezug auf den Film. Natürlich hat Selbstmord auch immer eine gesellschaftbezogene Bedeutung, in Japan zum Beispiel. Dort ist er ganz anders integriert. Hier ist es ja eine moralisch verwerfliche Sache, in Japan, bzw. in ganz Asien war das nie der Fall. Es war schon immer eine akzeptierte Form, um etwa die Ehre wiederherzustellen. Also egoistisch ist der Selbstmord nicht.
Liechti: In der Schweiz. Allerdings an verschiedenen Orten. Auch die Großstädte sind nicht immer die Gleichen.
Ricore: Welche Botschaft haben Sie für Ihre Zuschauer?
Liechti: Es ist eine Art von Gesellschaftskritik, die ich in dem Film formuliere. Was ausgedrückt wird, ist die radikale Verweigerung, das mitzumachen, was einem angeboten wird, den Konsum also. Die radikalste Verweigerung ist eben der totale Verzicht auf Essen.
Ricore: Es soll also die Askese ins Unendliche gesteigert werden?
Liechti: Naja, also Askese hat dann wieder diesen religiösen Aspekt. Zwar kommt der auch hinein, was wohl letztlich immer der Fall ist, wenn man stirbt. Da kommen immer religiöse Reflexionen, ob man will oder nicht, bei ihm ja auch. Ausschlaggebend war aber, dass ihm das Angebot in der Gesellschaft nicht gereicht hat. Er hat keine Befriedigung gefunden und konnte auch selbst nichts aus seinem Leben machen. Daraus entstand dann der Wunsch nach kompletter Verweigerung. Auf der anderen Seite ist der Film ein Plädoyer für das Leben. Indem man es hergibt zeigt sich erst seine Kostbarkeit.
Ricore: Geht es um eine Aufforderung an die Zuschauer zu kämpfen und niemals aufzugeben?
Liechti: Absolut. Viele Zuschauer erzählten mir, sie hätten den Film als eine Art Reinigung empfunden, nahezu eine katharsische Wirkung verspürt. Während es Films hätten sie gelitten, am Ende dann ein riesige Erleichterung erlebt.
Ricore: Woher kommt die Erleichterung?
Liechti: Der Wert des eigenen Lebens wird mal wieder hinterfragt, man wird sich bewusst, wie wertvoll es ist. Ebenso ist man erleichtert, dass man nicht ein solches Leid erfahren muss, wie der Protagonist.
Ricore: Inwiefern ist ein Selbstmord egoistisch?
Liechti: Mit Egoismus hat das meiner Ansicht nach nichts zu tun, mehr mit Egozentrik. Jeder der Selbstmordgedanken hegt, ist extrem selbstbezogen, bezieht die Tat auf seine Person. Diese ethnografischen Überlegungen spielten allerdings keine wichtige Rolle in Bezug auf den Film. Natürlich hat Selbstmord auch immer eine gesellschaftbezogene Bedeutung, in Japan zum Beispiel. Dort ist er ganz anders integriert. Hier ist es ja eine moralisch verwerfliche Sache, in Japan, bzw. in ganz Asien war das nie der Fall. Es war schon immer eine akzeptierte Form, um etwa die Ehre wiederherzustellen. Also egoistisch ist der Selbstmord nicht.

Film Kino Text
Szene aus "Das Summen der Insekten"
Ricore: Wie bewerten Sie die moralische Verurteilung von Selbstmord?
Liechti: Ich halte Selbstmord für eine menschliche Möglichkeit, wie es auch viele andere gibt. Es ist eine sehr beruhigende Möglichkeit, dass man das Leben wählen kann.
Ricore: Steht jedem Menschen zu, selbst zu entscheiden, ob er leben will?
Liechti: Absolut. Natürlich hat man eine Verantwortung seinem Leben gegenüber. Die allerdings muss jeder für sich selbst finden. Ich fühle mich da keinen religiösen oder moralischen Vorgaben verpflichtet. Obwohl es heute noch so ist und auch früher schon so war, dass der Selbstmord etwas sehr anrüchiges hat, etwas Beschämendes. Es wird ja noch immer sehr häufig verschwiegen, wenn so etwas vorkommt. Viele haben das Gefühl, etwas sei schief gelaufen. Und das sehe ich nicht so. Es ist eben einfach so gelaufen.
Ricore: Was bedeutet Ausweglosigkeit für Sie?
Liechti: Sie stellen mir Fragen (lacht)... Wenn ich als Mensch das Gefühl habe, sämtliche Möglichkeiten durchgespielt zu haben, die sich mir bieten und trotzdem nicht dahin gelangt bin wo ich wollte, wäre das für mich eine ausweglose Situation.
Ricore: Wären sie in einem solchen Moment bereit Selbstmord zu begehen?
Liechti: Das kann man natürlich so nicht sagen. Ich glaube, da gehört schon ein Stück Entschlossenheit dazu, die ich jetzt für mich nicht vorwegnehmen kann. Wie wahrscheinlich jeder von uns, habe auch ich in meinem Leben schon mit Selbstmordgedanken gespielt, vor allem als ich noch jung war. Aber das hatte meist oberflächliche Gründe, es war keine ausweglose Situation, sondern mehr eine momentane Verzweiflung. Sollte sich tatsächlich einmal diese Ausweglosigkeit einstellen, würde ich den Selbstmord bestimmt als eine reale Möglichkeit in Betracht ziehen.
Ricore: Welche Rolle hat die Musik im Film gespielt?
Liechti: Eine zentrale Rolle. Der ganze Film, die ganze Geschichte hat für mich eine sehr physische Bedeutung. Der ganze Text wird sehr physisch erzählt, ohne das eine Art von psychologischer Analyse stattfindet, kein Lamento, nichts. Es geht um kreatürliches Leid, der ganze Film hat etwas Archaisches, sehr natürliches und direktes. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und hierfür war die Musik wichtig, nicht zuletzt, weil die Matthäus Passion gespielt wird.
Liechti: Ich halte Selbstmord für eine menschliche Möglichkeit, wie es auch viele andere gibt. Es ist eine sehr beruhigende Möglichkeit, dass man das Leben wählen kann.
Ricore: Steht jedem Menschen zu, selbst zu entscheiden, ob er leben will?
Liechti: Absolut. Natürlich hat man eine Verantwortung seinem Leben gegenüber. Die allerdings muss jeder für sich selbst finden. Ich fühle mich da keinen religiösen oder moralischen Vorgaben verpflichtet. Obwohl es heute noch so ist und auch früher schon so war, dass der Selbstmord etwas sehr anrüchiges hat, etwas Beschämendes. Es wird ja noch immer sehr häufig verschwiegen, wenn so etwas vorkommt. Viele haben das Gefühl, etwas sei schief gelaufen. Und das sehe ich nicht so. Es ist eben einfach so gelaufen.
Ricore: Was bedeutet Ausweglosigkeit für Sie?
Liechti: Sie stellen mir Fragen (lacht)... Wenn ich als Mensch das Gefühl habe, sämtliche Möglichkeiten durchgespielt zu haben, die sich mir bieten und trotzdem nicht dahin gelangt bin wo ich wollte, wäre das für mich eine ausweglose Situation.
Ricore: Wären sie in einem solchen Moment bereit Selbstmord zu begehen?
Liechti: Das kann man natürlich so nicht sagen. Ich glaube, da gehört schon ein Stück Entschlossenheit dazu, die ich jetzt für mich nicht vorwegnehmen kann. Wie wahrscheinlich jeder von uns, habe auch ich in meinem Leben schon mit Selbstmordgedanken gespielt, vor allem als ich noch jung war. Aber das hatte meist oberflächliche Gründe, es war keine ausweglose Situation, sondern mehr eine momentane Verzweiflung. Sollte sich tatsächlich einmal diese Ausweglosigkeit einstellen, würde ich den Selbstmord bestimmt als eine reale Möglichkeit in Betracht ziehen.
Ricore: Welche Rolle hat die Musik im Film gespielt?
Liechti: Eine zentrale Rolle. Der ganze Film, die ganze Geschichte hat für mich eine sehr physische Bedeutung. Der ganze Text wird sehr physisch erzählt, ohne das eine Art von psychologischer Analyse stattfindet, kein Lamento, nichts. Es geht um kreatürliches Leid, der ganze Film hat etwas Archaisches, sehr natürliches und direktes. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und hierfür war die Musik wichtig, nicht zuletzt, weil die Matthäus Passion gespielt wird.

Film Kino Text
Szene aus "Das Summen der Insekten"
Ricore: Was bezwecken Sie mit der Gegenüberstellung von Natur und Gesellschaft im Film?
Liechti: Es geht um die vollkommene Gleichgültigkeit der Natur uns gegenüber, die besonders im Wald sehr stark erfahrbar ist. Niemand und gar nichts kümmert sich um unsere Gegenwart, wenn wir im Wald sind. Zwar wird überall gesummt, gelebt und gewaschen, gestorben und geboren, gefressen. Es geht um das Werden und Vergehen, welches eine derartige physische Präsenz hat im Wald. Und genau dadurch wird die Einsamkeit verstärkt.
Ricore: Welche Einsamkeit meinen Sie?
Liechti: Meine eigene, als ich mich im Wald aufgehalten habe. Ich habe das als unendlich einsam empfunden.
Ricore: Was hat die Unendlichkeit des Waldes mit dem Menschsein an sich zu tun?
Liechti: Sonst ist man nicht in der Lage, sein eigenes, existenzielles Alleinsein so eindringlich zu empfinden. Das ist ein religiöses Gefühl, was auch die Nachdenklichkeit verstärkt. Im Wald kann man über Religion nachdenken, über seinen eigenen Körper, sein eigenes Sein. Im Wald geht das besser, als wenn man in irgendeinem Zimmer sitzt.
Ricore: Welche konkrete Wirkung geht vom Wald aus?
Liechti: Der Wald hat eine sehr archaische Grundstimmung. Wenn man in einem abgelegenen Wald ist, dann ist da sehr wenig Menschliches. Aber gleichzeitig spürt man auch, dass man ein Teil von diesem Ganzen ist. Das ganze gesellschaftliche, das ganze zivilisatorische ist weg, Man ist wieder ein Stück Natur und dem Ganzen genau so ausgesetzt wie die Pflanzen und Tiere im Wald, die sich einem gegenüber komplett gleichgültig zeigen.
Ricore: Haben Sie das Fehlen der Zivilisation im Wald durch die Vielzahl an Bildern kompensiert? Woher haben Sie die Bilder?
Liechti: Ich würde sagen, der Film setzt sich aus vier Bildebenen zusammen. Einmal ist da die Einführung, die das objektive Ereignis schildert. Die zweite Ebene ist die physische. Da habe ich versucht, möglichst intensiv darzustellen, wie es ist im Wald zu sein, vor allem in Bezug auf die Wetterstimmungen, die Geräusche, die Nacht, habe ich versucht zu zeigen, wie es sich zunehmend verstärkt und verändert. Die dritte Ebene ist die Erinnerung - schließlich kommt er ja aus einem urbanen Zusammenhang. Das sind die Bilder die er noch hat aus seinem herkömmlichen Leben, von seiner Reise. Die vierte Ebene ist die innere Welt. Man ist nicht mehr mit der Beobachtung der Umgebung beschäftigt, sondern sieht in sich hinein. Sei es, dass man träumt, dass man Sehnsüchte formuliert oder eben, wie es in diesem Fall ist, beginnt zu halluzinieren. Und das ist auch die persönlichste Ebene, in die ich mich selbst als Autor eingebracht habe. Ich habe versucht, die Situation auf meine Weise nachzuvollziehen.
Liechti: Es geht um die vollkommene Gleichgültigkeit der Natur uns gegenüber, die besonders im Wald sehr stark erfahrbar ist. Niemand und gar nichts kümmert sich um unsere Gegenwart, wenn wir im Wald sind. Zwar wird überall gesummt, gelebt und gewaschen, gestorben und geboren, gefressen. Es geht um das Werden und Vergehen, welches eine derartige physische Präsenz hat im Wald. Und genau dadurch wird die Einsamkeit verstärkt.
Ricore: Welche Einsamkeit meinen Sie?
Liechti: Meine eigene, als ich mich im Wald aufgehalten habe. Ich habe das als unendlich einsam empfunden.
Ricore: Was hat die Unendlichkeit des Waldes mit dem Menschsein an sich zu tun?
Liechti: Sonst ist man nicht in der Lage, sein eigenes, existenzielles Alleinsein so eindringlich zu empfinden. Das ist ein religiöses Gefühl, was auch die Nachdenklichkeit verstärkt. Im Wald kann man über Religion nachdenken, über seinen eigenen Körper, sein eigenes Sein. Im Wald geht das besser, als wenn man in irgendeinem Zimmer sitzt.
Ricore: Welche konkrete Wirkung geht vom Wald aus?
Liechti: Der Wald hat eine sehr archaische Grundstimmung. Wenn man in einem abgelegenen Wald ist, dann ist da sehr wenig Menschliches. Aber gleichzeitig spürt man auch, dass man ein Teil von diesem Ganzen ist. Das ganze gesellschaftliche, das ganze zivilisatorische ist weg, Man ist wieder ein Stück Natur und dem Ganzen genau so ausgesetzt wie die Pflanzen und Tiere im Wald, die sich einem gegenüber komplett gleichgültig zeigen.
Ricore: Haben Sie das Fehlen der Zivilisation im Wald durch die Vielzahl an Bildern kompensiert? Woher haben Sie die Bilder?
Liechti: Ich würde sagen, der Film setzt sich aus vier Bildebenen zusammen. Einmal ist da die Einführung, die das objektive Ereignis schildert. Die zweite Ebene ist die physische. Da habe ich versucht, möglichst intensiv darzustellen, wie es ist im Wald zu sein, vor allem in Bezug auf die Wetterstimmungen, die Geräusche, die Nacht, habe ich versucht zu zeigen, wie es sich zunehmend verstärkt und verändert. Die dritte Ebene ist die Erinnerung - schließlich kommt er ja aus einem urbanen Zusammenhang. Das sind die Bilder die er noch hat aus seinem herkömmlichen Leben, von seiner Reise. Die vierte Ebene ist die innere Welt. Man ist nicht mehr mit der Beobachtung der Umgebung beschäftigt, sondern sieht in sich hinein. Sei es, dass man träumt, dass man Sehnsüchte formuliert oder eben, wie es in diesem Fall ist, beginnt zu halluzinieren. Und das ist auch die persönlichste Ebene, in die ich mich selbst als Autor eingebracht habe. Ich habe versucht, die Situation auf meine Weise nachzuvollziehen.

www.peterliechti.ch
Peter Liechti
Ricore: Was waren ihre Assoziationen während der vierten Ebene?
Liechti: Bis zu einem gewissen Grad kann man sagen, Anything Goes. Das geht aber nur solange die Bilder etwas Entrücktes im weitesten Sinne darstellen. Es geht um etwas nicht mehr fassbares, aber trotzdem sehr persönliches.
Ricore: Sie werden häufig als eigensinnigster Filmemacher der Schweiz bezeichnet. Finden Sie sich mutig?
Liechti: (lacht) Ich glaube, am meisten Mut gehört dazu, einen schlechten Film zu machen, davor hat jeder Angst. Es braucht generell Mut, sich mit einem Film zu exponieren, das auf jeden Fall. Das stimmt in meinem Fall. Ich suche den persönlichen Ausdruck, eine eigene Sprache. Das ist auch so, wenn ich ins Kino gehe. Ich möchte Filme sehen, die eine Unterschrift haben. Ich möchte keine anonymen Filme sehen. Deshalb mache ich mich natürlich angreifbarer, als bei einem Tatort.
Ricore: Ihr nächster Film soll auch wieder sehr persönlich werden. Was ist das Besondere daran?
Liechti: Davor habe ich riesige Angst, dass muss ich zugeben. Aber ich kann das Projekt nicht mehr verschieben, weil meine Eltern schon zwischen 85 und 90 Jahren sind. Deshalb mache ich den Film jetzt. Sonst wird das nichts mehr.
Ricore: Wie werden ihre Eltern im Film zu sehen sein?
Liechti: Die Hauptsache wird sein, dass ich ihnen zusehe und zuhöre. Es wird darum gehen, ihr persönliches Leben zu übertragen auf einen generellen Zustand, auf die allgemeine Situation alter Menschen, um den Alltag der ganzen alten Generation heutzutage. Den persönlichen Teil in Form der Interviews mit meinen Eltern möchte ich eigentlich übersetzen, in ein Kasperletheater, sozusagen in ein Familientheater. Ich möchte auf keinen Fall meiner Mutter oder meinem Vater ein Mikrofon vor das Gesicht halten. Das Ganze soll leicht ironisiert übersetzt werden.
Ricore: Meinen Sie richtige Kasperlepuppen?
Liechti: Im Grunde ja. Ich bin gerade noch dabei, herauszufinden, ob das auch so geht. Die Puppen dienen auch dazu, ein bisschen Abstand zu meinen Eltern zu erzeugen.
Ricore: Wann soll das Projekt starten?
Liechti: Das wird noch mindestens zwei Jahre dauern. Es geht mal wieder um die Finanzen. Da ich die Filme selbst produziere, befinde ich mich gerade in der ungemütlichsten Phase des Filmemachens. Irgendwie muss ich die Finanzierung hinkriegen.
Ricore: Vielen Dank für das Gespräch.
Liechti: Bis zu einem gewissen Grad kann man sagen, Anything Goes. Das geht aber nur solange die Bilder etwas Entrücktes im weitesten Sinne darstellen. Es geht um etwas nicht mehr fassbares, aber trotzdem sehr persönliches.
Ricore: Sie werden häufig als eigensinnigster Filmemacher der Schweiz bezeichnet. Finden Sie sich mutig?
Liechti: (lacht) Ich glaube, am meisten Mut gehört dazu, einen schlechten Film zu machen, davor hat jeder Angst. Es braucht generell Mut, sich mit einem Film zu exponieren, das auf jeden Fall. Das stimmt in meinem Fall. Ich suche den persönlichen Ausdruck, eine eigene Sprache. Das ist auch so, wenn ich ins Kino gehe. Ich möchte Filme sehen, die eine Unterschrift haben. Ich möchte keine anonymen Filme sehen. Deshalb mache ich mich natürlich angreifbarer, als bei einem Tatort.
Ricore: Ihr nächster Film soll auch wieder sehr persönlich werden. Was ist das Besondere daran?
Liechti: Davor habe ich riesige Angst, dass muss ich zugeben. Aber ich kann das Projekt nicht mehr verschieben, weil meine Eltern schon zwischen 85 und 90 Jahren sind. Deshalb mache ich den Film jetzt. Sonst wird das nichts mehr.
Ricore: Wie werden ihre Eltern im Film zu sehen sein?
Liechti: Die Hauptsache wird sein, dass ich ihnen zusehe und zuhöre. Es wird darum gehen, ihr persönliches Leben zu übertragen auf einen generellen Zustand, auf die allgemeine Situation alter Menschen, um den Alltag der ganzen alten Generation heutzutage. Den persönlichen Teil in Form der Interviews mit meinen Eltern möchte ich eigentlich übersetzen, in ein Kasperletheater, sozusagen in ein Familientheater. Ich möchte auf keinen Fall meiner Mutter oder meinem Vater ein Mikrofon vor das Gesicht halten. Das Ganze soll leicht ironisiert übersetzt werden.
Ricore: Meinen Sie richtige Kasperlepuppen?
Liechti: Im Grunde ja. Ich bin gerade noch dabei, herauszufinden, ob das auch so geht. Die Puppen dienen auch dazu, ein bisschen Abstand zu meinen Eltern zu erzeugen.
Ricore: Wann soll das Projekt starten?
Liechti: Das wird noch mindestens zwei Jahre dauern. Es geht mal wieder um die Finanzen. Da ich die Filme selbst produziere, befinde ich mich gerade in der ungemütlichsten Phase des Filmemachens. Irgendwie muss ich die Finanzierung hinkriegen.
Ricore: Vielen Dank für das Gespräch.
erschienen am 5. Mai 2010
Zum Thema

Peter Liechti wurde 1951 in St. Gallen geboren. Bevor er ein Diplom als Kunstlehrer erwarb, studierte der spätere Regisseur Kunstgeschichte an der Universität von Zürich. Seit 1983 arbeitet er zudem als Produzent, Kameramann und Drehbuchautor. Liechti ist der Ansicht, dass Filme eine Unterschrift brauchen, unsignierte Filme mag er nicht. So sind seine Werke stets daran erkennbar, dass sie sehr persönliche Geschichten erzählen. Als nächstes plant er eine Geschichtsrevision über seine Eltern und..
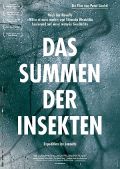
Das Summen der Insekten (Kinofilm)
Ein junger Mann fasst den Entschluss, sich durch Nahrungsentzug in einem abgelegenen Waldstück zu töten. Akribisch dokumentiert er seinen körperlichen wie seelischen Verfallsprozess in einem Tagebuch. Peter Liechti experimentiert filmisch mit dem Tabu Selbstmord und setzt seine Gedanken dazu gewagt in Szene. Durch die Verwendung klassischer Musik gelingt es ihm den Ausnahmezustand des Sterbenden ohne konkrete Bilder in die Vorstellungskraft des Zuschauers zu transportieren.